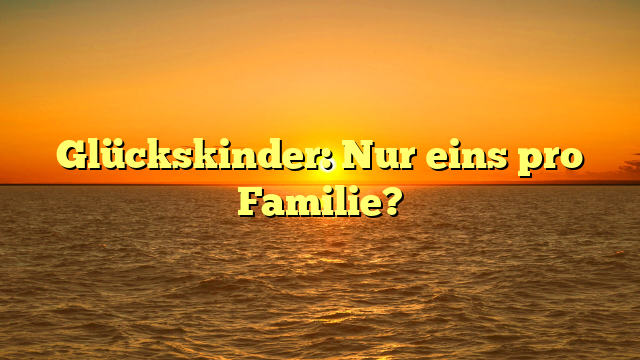Unsere Autorin ist ein Glückskind, meint jedenfalls ihre Schwester. Und die ist sich sicher, dass es davon pro Familie nur eines geben kann.
Jeden ersten Sonntag im August wünsche ich mir eine Schwester. Dann ist nämlich offizieller “Tag der Schwestern“, und das Internet quillt über vor Herzen, lustigen Kindheitserinnerungen und gegenseitigen Liebeserklärungen. Dazu Fotos von strahlenden Frauen, die sich umarmen, anlächeln, an den Händen halten. Aber auch persönlich kenne ich Schwestern, die zusammen eine Firma oder WG gegründet haben. Oder welche, die die Kinder der anderen mit großlieben und bemuttern und erziehen. Schwestern als Glücksbringer fürs Leben.
Wie gerne hätte ich so eine, denke ich dann. Wir wären wie die Olsen-Sisters. Wie Hanni und Nanni. Schneeweißchen und Rosenrot. Ich habe aber eine andere – und wir sind Goldmarie und Pechmarie. So sieht sie uns, und da sie die Ältere ist, hat sie sicher recht. Mehr oder minder heimlich denkt sie, ein Leben als unvergleichliches Einzelkind wäre besser gewesen: ihr Pech, dass ich geboren wurde. Es gibt da ein Foto meiner Taufe. Unsere Mutter hält mich schreiendes Baby freudig meiner Schwester entgegen. Doch diese verweigert die Annahme, Körper und Gesicht: eine einzige Abwehrmaßnahme. So, als wäre eine kleine Schwester das Letzte, was sie sich gewünscht hatte – was wohl auch so war. Denn jetzt musste sie teilen. Und geteilte Freude war für sie halbe Freude, nicht die sprichwörtlich doppelte.
Sie ist sieben Jahre älter als ich, auch ähnlich sahen wir uns nie. Seltsamerweise wurden wir aber identisch eingekleidet, wie Zwillinge, bis meine Schwester in die Pubertät kam. Der direkte Vergleich fing also früh an. Unsere größte Gemeinsamkeit wurde der Wettbewerb, wer nun die bessere, erfolgreichere Tochter war – liebenswerter eben. Als wäre der Familienkosmos ein Planet, dessen rare Bodenschätze aus Glück und Liebe bestünden. Und als hätte ich zur Geburt einen Bagger bekommen, um nach diesen zu schürfen, sie nur eine kleine Plastikschippe.
Schwester oder Rivalin?
Warum man eine Schwester als Rivalin sieht, im Gegensatz zu einer Freundin, der man ihr Glück nicht nur verzeiht, sondern es feiert? Ich meine, weil man unterschwellig denkt: Wir hatten die gleichen Startbedingungen. Waren zwei Lose der gleichen Genlotterie. Das Leben der anderen hätte der eigene Hauptpreis sein können. Man fühlt es vielleicht umso mehr, je unzufriedener man mit dem eigenen Leben ist.
Ja, es sind traditionell die Erstgeborenen, denen der Thron zusteht, der Erbhof oder das Familiengeschäft – während nachfolgende Geschwister in die Welt hinausziehen müssen, um ihr eigenes Glück zu machen. Laut psychologischen Studien sind auch heute noch die Erstgeborenen oft erfolgreicher als ihre Geschwister. Aber sollten wir zwei nicht außer Konkurrenz laufen, da es nix zu erben gibt, außer dem unterschwelligen Auftrag, die Lebensträume unserer Eltern zu erfüllen? Ist das nicht eine Hypothek, die uns beide belastet?
Solange ich ihr dabei wenigstens körperlich und intellektuell unterlegen war, ging das noch gut. Ich war ihr größtes Fan-Girl. Als ich ihr über den Kopf wuchs und sie mit 20 fast 20 Zentimeter überragte, fiel ich aus dieser Rolle. “Du bist nicht größer, nur länger!”, sagte meine Schwester und arbeitete noch verbissener daran, die Größte von uns beiden zu bleiben. Das ging am leichtesten, indem sie mir sagte, wie viel dümmer, fauler und oberflächlicher ich als sie wäre. Dass ich einfach bei allem immer nur Glück hatte, welches sie durch Fleiß und Intelligenz eigentlich doppelt verdient gehabt hätte. Unverdientes Glück also, was mir ihrer Meinung nach in den Schoß fiel und wodurch ich jede Aufnahmeprüfung bestand, jeden Studienplatz bekam, jede Wohnung und jeden Mann. Ich verstehe: Gustava Gans als Schwester ist schwer erträglich! Dass ich in Vorbereitung für den Glücksfall aber auch wie verrückt gelernt, geschuftet, geplant und trainiert hatte, kann oder will sie nicht sehen. Dabei hätte ich gern eine Schwester, mit der ich jeden Glücksfall teilen kann. Die Anteil daran nimmt, ohne mir sofort zu sagen, welchen Anteil sie daran hat, weil sie mir immer Vorbild gewesen war, den Weg geebnet, insgesamt die Rutsche auf dem Spielplatz des Lebens für mich frei gemacht hatte. Und wie auf einer Wippe kann sie logischerweise nur unten sein, sobald ich oben bin.
Glück ist keine Einbahnstraße
Als ich mit Ende 30 ein Wunschkind bekam, war das die erste wichtige Lebenserfahrung, die ich ihr voraushatte. Damals rief ich sie spontan an, um mein Glück mit ihr zu teilen. “Ich bin schwanger!”, platzte ich nach kurzem Vorgespräch heraus. Immerhin würde sie Tante werden! “Und darüber soll ich mich freuen, oder was?”, fragte sie schneidend. “Äh. Ja, wieso?”, erwiderte ich in der Hoffnung auf einen schlechten Scherz. “Typisch! Das ist so rücksichtslos von dir! Ich hätte vielleicht auch gerne ein Kind gehabt, aber es hat nie geklappt. Und du hast mal wieder so ein Glück, wirst einfach schwanger – und jetzt soll ich mich für dich freuen? Nein, damit muss ich erst mal klarkommen”, rief sie. Und legte auf. Ein gelogenes “Herzlichen Glückwunsch!” wäre mir lieber gewesen. Ich heulte. Und es waren nicht nur die Hormone.
Geheiratet haben wir übrigens beide, geschieden bin nur ich. Für sie ein winziger Moment der ausgleichenden Gerechtigkeit: Als unsere Mutter krank wurde, ich unbemannt mit meinen Kindern anreiste und meine Schwester mit ihrem Gatten, rief sie in aller Beisein froh: “Zumindest kann ICH euch heute einen Schwiegersohn mitbringen!” Herzlichen Glückwunsch.
Eifersucht und Neid unter Schwestern sind normal, sagen Barbara und Cordula Ziebell. Die Schwestern und Therapeutinnen bieten seit 2008 Coaching-Kurse für, na klar, Schwestern an, ihr Buch “Schwesternbande. Wie lebendige Schwestern-Beziehungen gelingen” ist gerade erschienen: “Die idealisierende Vorstellung, Schwestern müssten sich innig lieben und zusammenhalten, hat sich als Klischee festgesetzt. Erfüllen Schwestern diese Erwartung nicht, gelten sie als streitsüchtig, empfindlich, schwierig oder zickig”, meinen die beiden. Schwestern würden sich (unbewusst) an diesen Idealvorstellungen orientieren. Weichen sie davon ab, ist der Leidensdruck groß: “Viele trauen sich in unseren Workshops erstmalig davon zu erzählen, wie sehr sie dann ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle quälen”, wissen die beiden aus Erfahrung.
Gibt es überhaupt die perfekte Schwester?
Ich bin also nicht allein mit meinem Schwesternliebeskummer – es wird nur nicht darüber gesprochen. Dabei wünschen wir uns doch prinzipiell alle Schwestern wie in “Little Women” und wie bei Jane Austen, oder? Frauen, die sich gerade bei aller Unterschiedlichkeit gegenseitig für ihre Andersartigkeit bewundern. Die sich aufeinander verlassen und vertrauensvolle Gespräche führen können. Dafür habe ich meine Freundinnen. Meine Schwester und ich können uns noch nicht mal über unsere Kindheitsgeschichte einigen. Doch auch das sei normal, sagen die Ziebell-Schwestern. Krisen entstünden, wenn man meine, die andere müsse doch die gleiche Sichtweise haben wie man selbst, da man in der gleichen Familie aufgewachsen ist. “Machen wir uns bewusst, dass wir nicht davon ausgehen können und dürfen, dieselbe Realität zu erleben wie unsere Schwester. Wir sollten offen bleiben für die subjektiven Wahrheiten der anderen”, erklären sie.
Doch damit hapert es bei uns – jede beharrt auf ihrer Deutungshoheit. Will gesehen werden, mit ihrer Geschichte, ihren Verletzungen. Theoretisch sind wir beide schon überreif, benehmen uns aber immer noch kindisch. Mein Hirn und mein Herz haben da getrenntes Sorgerecht für mich: Der Kopf sagt, dass sie und ich es nie zu einem dieser “Sie ist das beste Geschenk, das meine Eltern mir je gemacht haben”-Memes bringen werden. Mein Herz will es trotzdem nicht glauben. Aber es kann mittlerweile damit leben. Wir kommunizieren eigentlich nur noch wegen unseres alten Vaters. Wir plaudern, aber reden nicht. Doch zu unseren Geburtstagen schreiben wir uns Glückwunschkarten. Dazwischen laufen unsere Lebenswege ohne weitere Berührungspunkte.
Meine Schwester hat nie Kinder bekommen, dafür eine ununterbrochene, hochrangige Karriere in einem Konzern. Den Lohn daraus wird sie mir bis in ihre hohe Rente im hohen Alter voraushaben. Wer ist da letztendlich die Glücklichere? In welchem Maß wird das überhaupt gemessen? Gesundheit, Schönheit, Beliebtheit, Erfolg, Geld? Sollte uns das alles – die Eifersüchteleien, die Vergleiche – in zunehmendem Alter, mit abnehmender Schönheit und zunehmend stabilem Selbstbild nicht immer egaler werden? Anscheinend nicht: Als meine Firma mich zu Corona-Zeiten in Kurzarbeit schickte und ich zwischen Haushalt, Homeschooling und Geldsorgen fast durchdrehte, bat ich sie um Rat. “Da ist es ja doch ganz gut, dass ich keine Kinder bekommen habe”, kommentierte sie selbstzufrieden. Endlich hatte sie mal Glück gehabt. In meinem Unglück.
Source: New feed